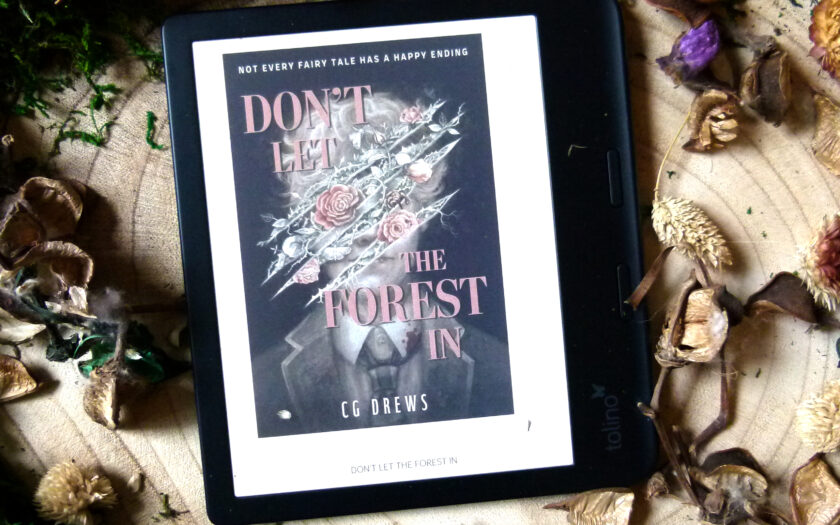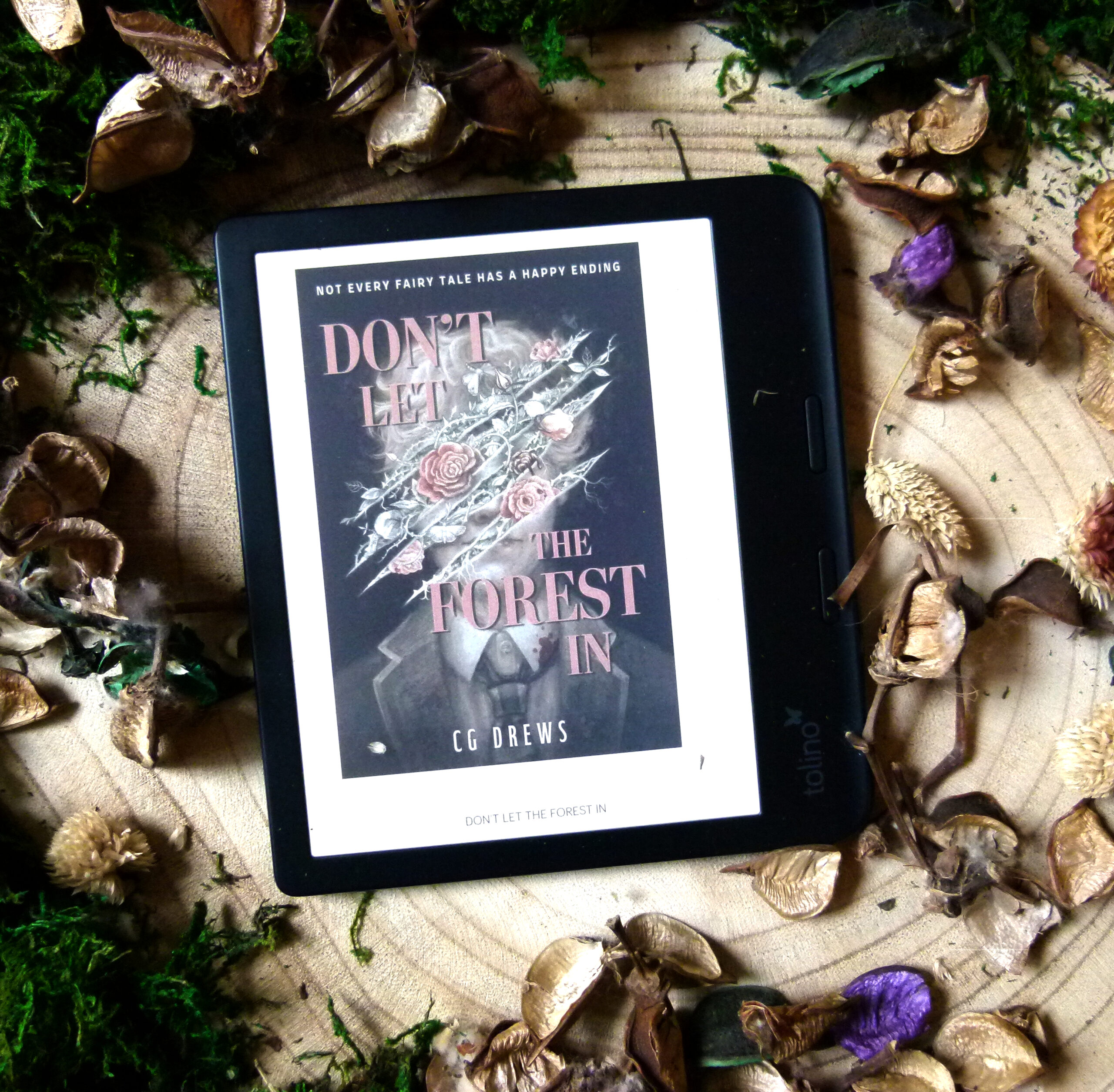Don’t Let The Forest In – C. G. Drews
Verlag: Feiwel & Friends | Seiten: 336 Erscheinungsjahr: 2024 |
Kurzbeschreibung
Andrew schreibt düstere Märchen und Thomas, sein bester Freund, erweckt die Geschichten seines Freundes zum Leben – und das wortwörtlich. Im Wald der privaten Wickwood Academy gehen die zwei Jungs nachts auf Monsterjagd. Was sie nicht ahnen: Die Monster aus Andrews Geschichten verlangen ein blutiges Opfer. Fieberhaft auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Monster zurückzuhalten, riskieren die Jungs nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Verstand. Sie müssen sich ihren Ängsten, aber vor allem ihren Gefühlen für einander stellen.
CN: Selbstverletzung, Tod, Trauer, Depression, Gore
Meine Meinung
Wer hier schon eine Weile lang mitliest, der*die weiß, dass ich zwar gelegentlich Thriller und Krimis lese, ich mich aber vom Horror-Genre und von psychologischer Fiktion fernhalte. Bei der Lektüre dieses Romans habe ich mich aus meiner Komfortzone herausgewagt und zwar wegen der LGBTQIA+ (besonders wegen der asexuellen) Repräsentation. Dieser Young Adult Roman gehört in die Kategorie psychologischer Horror und ich nehme es vorweg: Obwohl es ein Young Adult Roman ist, fand ich das Geschriebene teilweise schon etwas verstörend – aber ich gehöre auch eher zu den Zartbesaiteten. Es war weniger ein Grusel- als viel mehr ein Ekelgefühl, das gelegentlich in mir hochkam. Dennoch hat der Roman eine Art Faszination in mir hervorgerufen und einen Sog entwickelt, dem ich nicht widerstehe konnte, weshalb ich nur so durch die Seiten geflogen bin.
Von Anfang an ist mir die Prosa aufgefallen. Ich würde sie als sehr gewählt und gewollt, teilweise auch konstruiert, bauschig und prätentiös beschreiben – das ist definitiv Geschmackssache. Für diesen Roman hat es mMn gut funktioniert. Die Autorin zielt auf eine düster-akademische Atmosphäre ab, die sie mit gewagten Griffen ins Wörterbuch und in einen Metaphern-Fundus realisiert. Die sprachlichen Bilder nehmen Walddunkelheit, Verfall, Fäule und naturhafte und menschliche Düsternis auf und die Figuren baden förmlichen darin – aber die Bilder funktionierten leider nicht immer gleich gut oder sorgten für eine Überladung des Textes.
„The night was a living thing, breathing with them as they stood in the forest. Moss thickened in their lungs and they could taste autumn leaves.” (Kapitel 14)
Ich hatte auch das Gefühl, dass sich die Autorin sehr stark von den Motiven der Romantik-Epoche des 18. Jahrhunderts inspirieren ließ. Folgende Motive stehen im Roman im Vordergrund: die Nacht, der Wald, die Sehnsucht (nach Liebe, dem Tod), das Übernatürliche, das Märchenhafte und das Unbewusste, eine gewisse Weltflucht und das Sprengen verstandesmäßiger Grenzen. Das alles vermischt sich mit der Ästhetik des Dark Academia. Während der Autorin das dunkel-düstere Wald-Setting außerordentlich gelingt, bleibt der Schauplatz des Internats sehr weit dahinter zurück. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Autorin dafür zu stark auf die stereotypischen Bilder verlässt, die Leser*innen dieses Genres idR bereits im Kopf haben. Dieser Plan ist dann bei mir nur teilweise aufgegangen.
Der Horror wird nicht nur versprachlicht, sondern auch verbildlicht. Der Roman enthält Abbildungen der Monster, gegen die die Jungen kämpfen müssen. Diese Abbildungen haben mir echt gut gefallen und haben dem Ganzen eine weitere Dimension des Vorstellens hinzugefügt. Da sind Monster mit unterschiedlich verformten Körperteilen und unheimlichen Fähigkeiten; da ist Natur, die einen eigenen Willen entwickelt und wirklich, aber wirklich invasiv wird; da werden Verletzungen bis ins kleinste Detail beschrieben. Der Horror geht hier Hand in Hand mit Ekel und Entsetzen.
An der Geschichte gefiel mir besonders die Idee, Geschriebenes und Gezeichnetes lebendig werden zu lassen. Andrews Märchen haben es mir auch angetan und ich bin ehrlich: Davon hätte ich gerne eine eigene Ausgabe. Diese Geschichten, die man in den Text eingeflochten vorfindet, sind düster, hoffnungslos und schmerzhaft, aber auf eine makabere Art und Weise faszinierend. Die Märchen spielen mit den Versionen der bekannten Volksmärchen: Verzerren und schreiben sie neu und erfinden Neues hinzu.
Der Kampf der Jungs gegen die Monster wird eindrücklich geschildert und vor allem die fieberhafte Suche nach einer Lösung hatte es mir angetan – vor Aufregung war ich ganz hibbelig. Die Auflösung der Geschichte, die den Ursprung der Monster erklärt, fand ich einerseits etwas überstürzt angesetzt, aber andererseits auch todtraurig und hat mich glatt zum Heulen gebracht. Rückblickend fügen sich die offenen Enden der Gespräche und der beschriebenen Eindrücke sehr gut zusammen und betonen Andrews Rolle als unzuverlässigen Erzähler. Während das Ende an sich sehr viel Platz für Spekulation und Interpretation lässt, fügt es sich perfekt in das allgemeine Bild des Unbewussten und Unerklärlichen. Die Grenzen meiner Rationalität wurden hier definitiv gesprengt.
Nun zur LGBTQIA+ Repräsentation: Im Roman begegnen wir schwulen, lesbischen und asexuellen Figuren. Leider kommt der Roman auch nicht ohne gewisse Anfeindungen und Übergriffe gegen diese Personengruppe aus (zB zerstörte Pride Flags). Im Vordergrund der Geschichte stehen einerseits Andrews Asexualität und sein Umgang damit in Bezug auf sich selbst und andererseits seine Gefühle für seinen besten Freund Thomas. Die Art und Weise wie die Autorin Andrews Asexualität darstellt, fand ich überzeugend und nachvollziehbar. Die Gespräche und Gedanken darüber halten sich im Vergleich zur restlichen Handlung die Waage und nehmen keines Falls Überhand.
“He could imagine Thomas’s soft lips on his for approximately five seconds before the entire construction crumpled like wet paper. Because there was always after. There was always more. People didn’t just kiss and continue on with their lives. They undid buttons and touched mouths to hot skin and lost themselves within each other. And Andrew didn’t want to think about any of that. At all. Ever.” (Kapitel 3)
Zwischen Andrew und Thomas gibt es eine spürbare, aber vielleicht nicht ganz gesunde Anziehung. Es geht zwar sehr viel um Begehren, aber weniger um ein sexuelles Verlangen. Es ist ein Begehren, dass darauf abzielt, die innere Leere zu füllen, mit einer Person durch körperliche Nähe ein Ganzes zu werden. Manche Beschreibungen dieser Sehnsucht fand ich nicht ganz unproblematisch, man könnte die Anziehung oder gleich die ganze Beziehung der beiden toxisch oder einfach nur dysfunktional nennen.
„He needed Thomas, needed their lungs sewn inside each other so he could remember how to breathe. He needed to take words from Thomas’s mouth and put them in his own so he had something to say.” (Kapitel 21)
Lustigerweise waren Andrew und Thomas keine Sympathieträger. Lana, eine der Nebenfiguren war mir um einiges sympathischer: Dass sie gut und gerne Contra gibt und ein „murder face“ statt eines Bitch Faces hat, hat sie mir ans Herz wachsen lassen. Zwar sind Andrew und Thomas die richtigen Hauptfiguren für die Geschichte, aber ich verspürte eine gewisse Distanz zu den beiden. Dazu waren mir die beiden viel zu verstörend.
Mein Fazit
Düster, makaber, verstörend und faszinierend – so würde ich die Lektüre von „Don’t Let The Forest In“ von C. G. Drews beschreiben. Für mich ein Ausflug in ein mir eher unbekanntes Genre, der sich gelohnt hat.