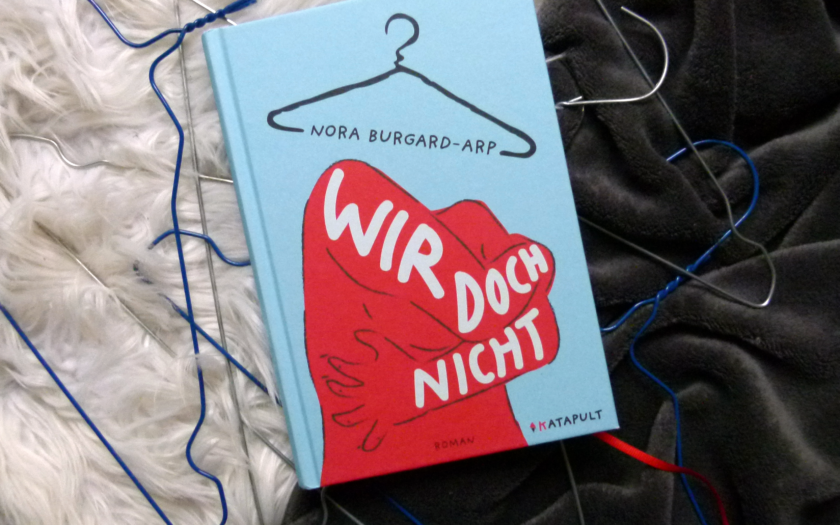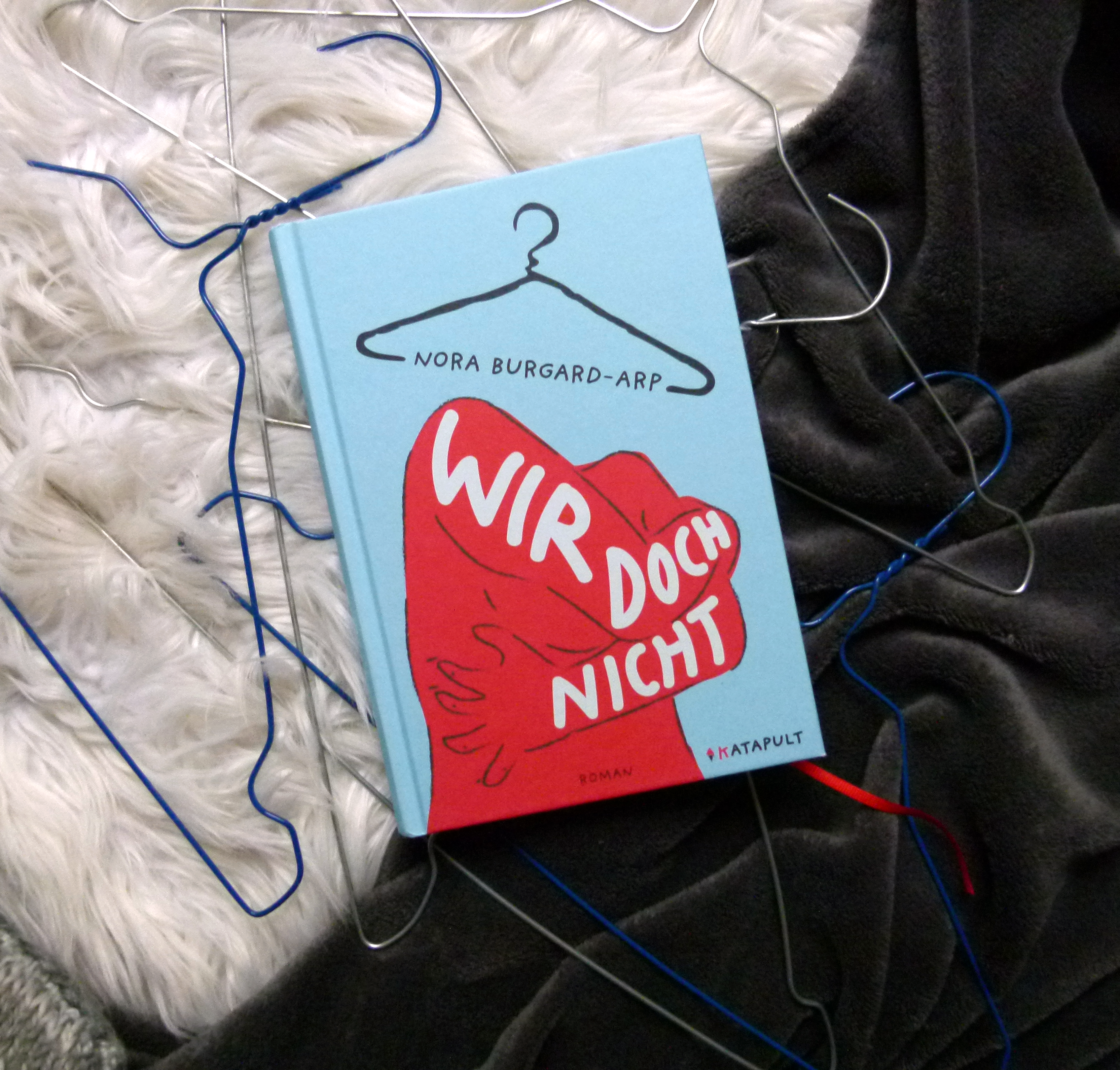Wir doch nicht – Nora Burgard-Arp
Verlag: Katapult Verlag | Seiten: 224 Illustratorin: Iris Ott | Erscheinungsjahr: 2022 |
Kurzbeschreibung
Hamburg, in der Zukunft. Das Deutschland wie wir es kennen gibt es nicht mehr. Die SfDD (Sieg für Deutschland und die Deutschen) hat aus Deutschland eine Diktatur gemacht. Mathilda ist 37 Jahre alt und wird ungewollt schwanger – doch auf eine Abtreibung steht eine lebenslange Haftstrafe. Mathilda beendet ihre Schwangerschaft heimlich mit einem Kleiderbügel – nicht einmal ihrem Mann Finn erzählt sie davon, denn sie weiß, dass sie niemandem trauen kann. Diese innere, heimliche Rebellion gegen das System hat Folgen: Ihre inneren Verletzungen entzünden sich und Mathilda muss eine Entscheidung treffen.
Meine Meinung
Einen einleitenden Satz für diese Rezension zu finden, ist mir sehr schwer gefallen. Denn dieser Roman hat in mir so viele unterschiedliche Emotionen hervorgerufen: Unglaube, Angst, Verblüffung und vor allem Entrüstung. In ihrem Roman „Wir doch nicht“ beschreibt die Autorin Nora Burgard-Arp eine dystopische Zukunft Deutschlands, nämlich eine rechte Diktatur. Das ist eine Zukunft, die ich nicht (er)leben möchte.
Aktuelle Krisenherde und Diskurse unserer Gesellschaft treibt die Autorin auf die Spitze: Abtreibungsverbot, Retraditionalisierung und Rückkehr zur Kernfamilie, Klimawandel, Entdigitalisierung, Siegeszug der Homöopathie, Überwachungsstaat, Zensur, Patriarchat, Staatsgewalt – das sind nur einige Themen, die in diesem Roman eine tragende Rolle spielen.
Die Ereignisse werden von der 37jährigen Mathilda geschildert, die, da sie eine Frau ist, die Konsequenzen dieser Diktatur knallhart zu spüren bekommt. Ihr Alltag besteht darin, zu putzen, zu kochen, sich um ihre Fruchtbarkeit zu kümmern und einmal in der Woche findet ein verpflichtender Stammtisch für die deutsche Frau statt. Dieser
„dient den deutschen Frauen sowohl zur Unterstützung, Bestärkung und Beratung auf dem Weg zur Mutterschaft und in ihrem Leben als Mutter als auch […] zur weiteren Aneignung der Leitlinien für Familie und Haushalt“ (S. 89).
Die Frau als Gebärmaschine – Da kommt doch wahre Lebensfreude auf… nicht – Albtraum für mich, die in ihrer Jugend (wenn auch nur scherzhaft – hahaha, ich lache immer noch) als Gebärmaschine bezeichnet wurde. Beim Lesen lernt man Mathildas Alltag kennen, ihren Mann und ihren Bekanntenkreis, darunter ihre beste Freundin Frida. Und wir lernen: Man kann niemandem trauen.
In (etwas oberflächlich gehaltenen) Rückblenden erzählt Mathilda von ihrem früheren Leben – also dem Leben vor der Diktatur und von der Übergangszeit: Sie beschreibt ihre Jugend, ihre Schulzeit und ihr Studium, ihre Beziehung zu ihrer feministischen Mutter. Man erfährt besonders wie dieser Systemwechsel sie als Person betrifft, wie sich ihr Leben langsam aber sicher verändert hat. Die beständigen Warnungen von ihrer feministischen Mutter stechen dabei ganz besonders hervor. An diesen Stellen hätte ich mir viel mehr Tiefe gewünscht.
Im Zentrum der Handlung steht das Abtreibungsverbot der SfDD (Sieg für Deutschland und die Deutschen) und wie es sich konkret auf Mathildas Leben auswirkt. Schon die ersten Seiten evozieren beim Lesen ein Gefühl von Beklommenheit, Hilflosigkeit und Mitgefühl. Von Beginn an klebte ich förmlich an dem Buch und kam auch nicht los: Man ist selbst so gefangen in dieser Diktatur, aus der es augenscheinlich keinen Ausweg gibt. Doch im Unterschied zu den Figuren kann man als Leser*in jederzeit das Buch zuklappen.
Es kommt zu einem allmählichen Eskalieren der Handlung: Es wird immer beklemmender und verstörender, Rebellion, Widerstand und dessen Bekämpfung verflechten sich für die Protagonistin in einer Spirale der Angst und Gewalt, unter der sie nicht nur psychisch, sondern auch physisch leidet.
Gegen Ende verlor der Roman leider ein bisschen seinen festen Griff, da sich die Ereignisse nur so überschlugen und es zu hektisch wurde, um einen klaren Überblick zu behalten. Dies ging zu Lasten der zuvor so eindrücklich evozierten Atmosphäre.
Aufgrund der begrenzten Perspektive, nämlich die einer Frau, die in dieser Gesellschaft keine Freiheiten mehr hat und nur auf zensierte Medien zurückgreifen kann, blieben bei mir viele Fragen offen, die vor allem das politische und wirtschaftliche Leben Deutschlands betreffen: Wie sieht es im restlichen Europa aus? Was machen die USA, Russland, China oder Japan? Schauen die einfach nur zu? Welche Länder haben sich noch radikalisiert? Wohin flüchten diejenigen, die dieses diktatorische System nicht mittragen wollen oder können (weil es sie ihr Leben kosten würde)? Was macht das Militär? Wie sieht unsere Wirtschaft aus? Welche Rolle spielt die Kirche? All diese Fragen lenkten mich gelegentlich ein bisschen zu sehr von der Handlung ab. Diese Unwissenheit, die die Protagonistin tagtäglich erlebt, war nur schwer zu ertragen.
Sinn und Zweck dieses Romans ist es, zu zeigen, wie sich eine Diktatur konkret auf das Leben der Einzelnen auswirken könnte. Es geht darum das Private zu zeigen, denn das Private ist Politisch. Es hätte mMn aber noch mehr „dystopisches Worldbuilding“ gebraucht. Mir ist klar, dass wir es mit einer Erzählerin zu tun, die selbst nicht viel weiß. Die Schranken sind Absicht. Aber auch die Rückblenden werden eher mit Scheuklappen erzählt. Um es einfach auszudrücken: Es gelingt der Autorin sehr gut, die alltägliche Unterdrückung darzustellen, auf gesamtgesellschaftlicher Ebener waren die Schilderungen weniger eindrücklich und rutschten teilweise ins Groteske und Unglaubwürdige ab. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich die fiktionale Diktatur für unglaubwürdig halte, sondern nur die Art und Weise wie die Autorin diese darstellt.
Während der Lektüre kommt man nicht umhin, die eigene Rolle in dieser fiktional-futuristisch-dystopischen Gesellschaft zu überdenken. Man fragt sich: Soll so die Zukunft aussehen? Könnte es wirklich so weit kommen? Wie konnte es in der im Roman geschilderten Gesellschaft so weit kommen: Geschichtsvergessenheit? Fehlen eines kritischen Bewusstseins? Desinteresse an Politik? Wäre man Mitläufer oder würde man laut „Wir doch nicht!“ rufen?
Die Illustrationen von Iris Ott bilden einen starken Kontrast zu diesen düsteren Zukunftsaussichten. Sie sind so zart und ausdrucksstark und passen genau deshalb so gut zur Geschichte. In ihnen steckt der Glaube an eine hoffnungsvolle Zukunft.
Mein Fazit
„Wir doch nicht“ von Nora Burgard-Arp ist eine Dystopie vom Feinsten. Die Lektüre des Romans lässt einen mit einem flauen Gefühl im Magen zurück und man blickt mit (noch) sorgenvollerem Blick (sofern das überhaupt noch möglich ist) auf die Politik und Gesellschaft unserer Gegenwart. Die Autorin lässt albtraumhafte Anklänge laut werden. Der Roman ist eine Mahnung, die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Absolute Leseempfehlung!
Weitere Meinungen zu “Wir doch nicht” von Nora Burgard-Arp
- Rezension von Von Buch zu Buch
- Rezension von the little queer review
- Rezension von Aus Liebe zum Lesen